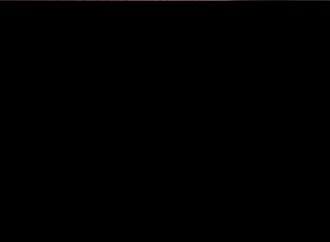E-Autos sind teuer in der Anschaffung, können die Zusatzkosten aber in vielen Fällen über geringere Aufwendungen für den Betrieb wieder reinholen. Künftig eröffnet sich auch noch eine andere Einnahmequelle.
Wenn das E-Auto nicht nur Strom lädt, sondern ihn auch wieder ins Netz abgibt, kann sich die Kosten-Nutzen-Rechnung für viele Halter massiv ändern. Denn bidirektionales Laden soll ihnen mehrere hundert Euro pro Jahr einbringen und so die Mobilitätskosten massiv senken. Die letzten Hürden für das Einspeisen von Akku-Energie werden wohl bald ausgeräumt sein.
Mit dem Elektro-Kleinwagen Renault 5 kommt nun der erste Pkw mit massentauglicher bidirektionaler Ladetechnik auf den Markt - zumindest in den höheren Ausstattungslinien. Der französische Autobauer kooperiert beim sogenannten ,,Vehicle-to-grid"-Ansatz (V2G, ,,Fahrzeug zu Netz") mit dem Ladetechnik-Spezialisten ,,The Mobility House", um die im Akku zwischengelagerte Energie an der Pariser Strombörse EPEX Spot zu verkaufen. Der Halter wird am Ertrag beteiligt, muss aber mit seinem Stromvertrag zur Renault-Tochter Mobilize umziehen. Zudem ist eine geeignete AC-Wallbox nötig.
Weitere Autohersteller dürften schnell folgen. Volvo etwa plant für sein neues Elektro-Flaggschiff EX90 schon ein vergleichbares Angebot. Und auch Mercedes hat bereits angekündigt, dass sein kommender Einstiegs-Stromer das Einspeisen von Akku-Strom ins Netz beherrschen wird. VW, Nissan, Mitsubishi, Hyundai und Kia haben zumindest bereits technisch für das bidirektionale Laden ausgelegte Fahrzeuge im Angebot.
Frank Spennemann, Leiter Smart Charging bei Mercedes-Benz Mobility, erläutert, wie das Geschäft mit dem Stromverkauf für den Kunden funktioniert: ,,Wenn ich beispielsweise im Sommer tagsüber überschüssigen Strom lade, tue ich das zu einem geringen Preis. Wenn Energie dann wieder knapper und teurer ist, kann ich sie von meinem Elektrofahrzeug als Speicher ins Netz zurückgeben und an der Strombörse verkaufen."
Das Puffern von Überschuss-Strom ist einerseits nachhaltig, weil es die Netzstabilität erhöht, senkt aber auch die eigenen Energiekosten. ,,Wir sehen in einem entsprechenden Service, der den Handel für den Mercedes-Kunden automatisiert, ein attraktives Potenzial", so Spennemann. Einschränkungen für die Mobilität soll der Handel weder bei den Schwaben noch bei anderen Anbietern bedeuten: In jedem Fall wird generell nur ein kleiner Kapazitätsbereich der Batterie für das Entladen genutzt, zudem können Nutzer oder ein KI-Assistent den Handel so programmieren, dass er optimal zu den aktuellen Reiseplänen passt. Das E-Auto soll so seinem primären Zweck - dem Transport - zu jeder Zeit nachkommen könne.
Zunächst dürfte das bidirektionale Laden ins öffentliche Netz allerdings ein Nischenphänomen bleiben. Erste Lösungen kommen nun zwar langsam auf den Markt, bleiben aber auf einzelne Pkw-Modelle und Hersteller beschränkt. Mit einer echten Wahrnehmbarkeit rechnet der Beirat der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur in einer nun veröffentlichten Roadmap erst für die Zeit nach 2025. Ab 2028 könnte die Technik aber durch Standardisierung und Interoperabilität einen echten Boom erleben. Bis dahin müssen den Experten zufolge aber noch einige bereits auf den Weg gebrachte Normen und technische Regeln in Kraft treten, vor allem, was Messung und Steuerung des Stromflusses betrifft.
Wie hoch der Ertrag an der Strombörse ausfallen könnte, hängt nicht zuletzt vom Nutzungsszenario des Halters, von der Dauer und Flexibilität der Fahrzeug-Standzeiten ab. In der Branche ist aber durchaus von mittleren dreistelligen Beträgen zu hören. Rund 500 bis 600 Euro pro Jahr dürften im Schnitt möglich sein. ,,Ein Stromhandel an der eigenen Wallbox sollte für den Kunden aber nicht zu komplex werden. Die Tarifstruktur muss einfach gestaltet sein, so dass es jeder versteht", warnt Spennemann. Auch die Stuttgarter dürften wohl auf ein Modell setzen, bei dem der Kunde den Strom nicht umständlich selbst vermarkten muss, sondern dies einer Art Makler überlässt.
Technisch gesehen ist das bidirektionale Laden heute kein großes Problem mehr. Dass es erst jetzt langsam startet, hat zum einen mit dem zunächst langsamen Hochlauf der E-Mobilität zu tun. Denn ein relevanter Markt existiert aus Sicht der potenzielle Anbieter erst ab einer gewissen Größe. Zum anderen steht aber auch das alternde und noch sehr analoge deutsche Stromnetz im Weg, ebenso die relativ komplizierte deutsche Regulierung, wenn es um Stromentnahme und -einspeisung jenseits von Kühlschrank und Fön geht. Nicht zuletzt fehlen hierzulande auch noch weitgehend die sogenannten ,,dynamischen Haushaltsstromtarife", die vor allem in Nordeuropa längst Standard sind.
Die Möglichkeit, Preisunterschiede über den Tagesverlauf auszunutzen, ist aber zwingend nötig für einen gewinnbringenden Handel an den Strombörsen. Noch haben zwar die allermeisten Haushalte einen fixen Preis, doch ab 2025 sind alle Stromversorger verpflichtet, variable und dynamische Stromtarife anzubieten. Auch intelligente Stromzähler (Smart Meter) sollen dann für jedermann verfügbar sein. Diese sind mit ihrem Internet-Anschluss für die Abfrage aktueller Strompreise für einen einträglichen Handel ebenfalls unabdingbar.
Bis es so weit ist, beschränkt sich das Anwendungsfeld für bidirektionales Laden hierzulande häufig auf das Puffern von Photovoltaik-Strom. Tagsüber dient das Auto als Verlängerung des Heimspeichers, nachts kann es dann Strom für die Versorgung des eigenen Haushalts liefern. VW etwa bietet eine entsprechende Infrastruktur für Halter seiner ID-Fahrzeuge an, inklusive Energiemanagementsystem und Gleichstrom-Wallbox (DC). Schon diese speziellen Ladegeräte sind sehr teuer, könnten heute noch durchaus fünfstellige Summen kosten.
Für breite Anwendung interessanter ist das bidirektionale Laden mit Wechselstrom (AC), das prinzipiell viele neue Wallboxen und auch einige aktualisierbare ältere Modelle beherrschen. Der Hardware-Aufwand am Stellplatz ist in diesem Fall also deutlich geringer, allerdings muss das Fahrzeug selbst über ein aufgerüstetes und etwas teureres Bordladegerät verfügen. Zudem leidet die Effizienz im direkten Vergleich mit der Gleichstrom-Technik ein wenig. Angesichts der deutlich geringeren Kosten dürfte das für die meisten Kunden aber keine Rolle spielen. Unter anderem setzen daher Renault und Volvo auf diesen Ansatz. Die Schweden lassen ihren Kunden sogar die Wahl und bieten sowohl Gleich- als auch Wechselstrom-Einspeisung an.
Ganz gleich welche Technik man nutzt: Der Stromverkauf allein wird wohl auf lange Sicht nicht die einzige Einkommensquelle für E-Autonutzer bleiben. Denn ab einer bestimmten Flottengröße können Deutschlands E-Mobile als eine Art virtuelles Kraftwerk zum integralen Bestandteil des Stromnetzes werden, Lastspitzen abfedern und Engstellen verhindern. Natürlich gegen Bezahlung, die in diesem Fall vom Netzbetreiber kommt. Das Geld, das der E-Autobesitzer für netzdienliche Leistungen erhält, ist allerdings auch eine Art Verschleißausgleich. Denn ständige Lade- und Entladevorgänge sind für die Batterie potenziell stressig. Der negative Effekt ist aber relativ gering, versichern die Autohersteller. Durch intelligente Steuerung und Anpassung an die übrigen Nutzungsgewohnheiten des Fahrzeughalters kann er zudem weiter minimiert werden.
Die Möglichkeit zum einträglichen Stromhandel würde E-Autos sicherlich noch einmal deutlich attraktiver machen. Zunächst nur für die Nutzer eines eigenen Stellplatzes, langfristig aber auch für alle anderen Halter. Darf man zunächst aus regulatorischen Gründen in Deutschland wohl nur an einem festen Anschlusspunkt ins Netz einspeisen, sollte das langfristig von jeder Ladesäule oder Wallbox aus möglich sein. Spätestens dann wird jeder E-Autofahrer zum Stromhändler im Nebenerwerb.